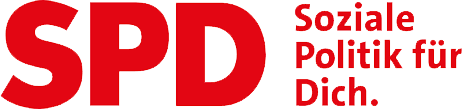Ein Kommentar
Die Union und die SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag ( Koalitionsvertrag) geeinigt. Eine kommentierte Kurzfassung gibt es auch (Kurzfassung). Nun liegt es an den SPD Mitgliedern über ihre Zustimmung zu dem Vertrag zu entscheiden. Im Folgenden soll auf einzelne Fragen zu diesem umfangreichen Papier eingegangen werden.
Im Folgenden soll kommentierend auf einzelne Fragen zu diesem umfangreichen Papier eingegangen werden.
Was könnte aus Sicht der SPD die wichtigste Maßnahme der Vereinbarung sein?
Von wesentlicher Bedeutung ist das Sondervermögen zur Finanzierung von öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur. Ziel dieser Maßnahme ist die teilweise marode Infrastruktur vor allem in den Bereichen Verkehr (Bahn!) und Schulen zu modernisieren und darüberhinaus den Umstieg in eine nachhaltige produzierende Wirtschaft zu beschleunigen.

Der Begriff Vermögen ist in diesem Zusammenhang durchaus zweifelhaft, da es sich in Wahrheit um die Erlaubnis für die Bundesregierung handelt, Schulden in Höhe von 500 Mrd. € für die Finanzierung eben dieser Investitionen aufzunehmen. Die Laufzeit der Ermächtigung beträgt 12 Jahre, so dass im Durchschnitt pro Jahr gut 40 Mrd. € ausgegeben werden dürfen. Das ist mit rund 1% von unserer gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung (BIP) ein sehr nennenswerter Betrag. Da er weitgehend zusätzlich zur den ohnehin geplanten Investitionen ausgegeben werden soll, sind in nächster Zeit starke belebende Impulse für unsere derzeit lahmende Wirtschaft zu erwarten. Zugleich dürfte Die Infrastruktur auf diese Weise durchgreifend verbessert werden.
Werden auch die privaten Investitionen gefördert?
Ja. Zum einen indirekt durch die deutlich höheren öffentlichen Investitionen, die erfahrungsgemäß auch private Investitionen auslösen, weil Unternehmen mehr Aufträge erhalten und die verbesserte Infrastruktur eine höhere Produktion lohnend macht.
Zum zweiten werden die privaten Investitionen aber auch direkt gefördert. Mittels großzügiger Abschreibungsmöglichkeiten (30%) für die kommenden drei Jahre erhalten Unternehmen einen starken Anreiz, zu investieren. Das dürfte sich als wirkungsvoll erweisen. Leider sind die Abschreibungen pauschal und nicht zielgerichtet auf die digitale oder ökologische Transformation und insofern ineffizienter als nötig. Eine eine an diese Bedingungen geknüpfte Investitionszulage wäre in dieser Hinsicht effektiver gewesen.
Zudem soll ein Deutschlandfonds geschaffen werden, an dem sich auch privates Kapital beteiligen gen kann und der private Investitionen fördern soll.
Die in drei Jahren angestrebten beginnenden Senkungen der Körperschaftsteuer um jeweils 1 Prozentpunkt pro Jahr für 5 Jahre beflügeln die Investitionen dagegen kaum. Sie sind als Prämie für Standorttreue und als entsprechende Umverteilung nach oben zu verstehen.

Wie soll Deutschland in den geopolitischen Konflikten bestehen?
Der Koalitionsvertrag enthält hierzu zum einen die wirtschaftliche Stärkung durch die massiven Investitionen. Zum zweiten durch eine intensivere wirtschaftliche und militärische Kooperation innerhalb der EU plus UK. Zum dritten durch Aufrüstung. Hierfür darf die Bundesregierung sich in unbegrenzter Höhe und zeitlich unbefristet verschulden. Damit ist sie in der Lage auf jede Herausforderung adäquat reagieren zu können.
Steigt durch die schuldenfinanzierten Ausgaben für Investitionen und Verteidigung die Verschuldung nicht zu stark an?
Die Ausgaben für Investitionen sind in dieser Hinsicht unproblematisch, da sie sich auf Dauer weitgehend selbst finanzieren. Jeder Euro, der investiert wird, erzeugt im Durchschnitt eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung von 1,50 € . Dadurch erhöhen sich die Steuereinnahmen und damit auch die Möglichkeiten die Schulden zu finanzieren.
Anders sieht es mit den Ausgaben für Verteidigung aus. Sie erzeugen in der Regel eine deutlich geringere gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung. Damit ist zu erwarten, dass die Zinszahlungen für diese Schulden den Bundeshaushalt langfristig belasten werden. Ökonomisch wäre es daher sinnvoll gewesen, diesen Posten betragsmäßig oder zumindest zeitlich zu begrenzen. Andererseits stärkt der Verzicht auf Begrenzungen die Verhandlungsposition der Regierung sowohl in der NATO als auch gegenüber Russland. Vor allem wird auf diese Weise ein Konflikt mit anderen Ausgaben z.B. für Soziales vermieden.

Was ist mit dem Bürokratieabbau?
Unsere Verwaltung soll vernetzt, effizient und leistungsfähig sowie niedrigschwellig und
benutzerfreundlich für alle erreichbar sein. Viele Vorgänge sollen in Zukunft antragslos erfolgen (z.B. Kindergeld) und viele Dokumentationspflichten für Unternehmen sollen reduziert werden. Wichtig wäre, vor allem Planungsprozesse zu straffen und zu flexibilisieren.
Ein Leitbild für Digitalisierung
Die Koalition strebt eine vorausschauende, vernetzte, leistungsfähige und nutzerzentrierte Verwaltung –antragslos, lebenslagenorientiert und rein digital mit gezielten Unterstützungsangeboten. Dazu gehört auch die Schaffung einer digitalen Identität für alle, mit der ein Zugang zu allen öffentlichen Leistungen möglich ist. Um dies zu erreichen ist ein sehr konsequentes Handeln im neu geschaffenen Digitalministerium erforderlich.
Werden die Renten gekürzt?
Erstmal nicht. Bis 2031 gilt, dass das Renteneintrittsniveau nicht unter 48% des letzten Netto Einkommensniveau fallen darf. Dabei bleibt der sog. Nachhaltigkeitsfaktor, der die finanziellen Belastungen, die durch den demographischen Wandel entstehen, zwischen Beitragzahlern und Rentnern aufteilt, in Kraft. Das heißt, wenn wegen abnehmender Beitragzahler der Rentenbeitrag eigentlich um einen bestimmten Prozentsatz steigen müsste, wird dieser Anstieg gedämpft, in dem sich der Anstieg der Renten, der ansonsten möglich gewesen wäre, verringert. Wenn als Folge dieser Dämpfung das Eintrittsniveau unter 48% sinkt, wird dies durch Steuermittel wieder ausgeglichen. Das bedeutet, diese Sicherung des Rentenniveaus wird bis 2031 von den Steuerzahlern, also nach finanzieller Leistungsfähigkeit, erbracht und nicht von den Beitragszahlern. Das ist vernünftig. Für die Bestimmung des Rentenniveaus nach 2031 soll eine Kommission Vorschläge entwickeln. Dann gilt es um das Rentenniveau zu kämpfen.
Was ist schmerzhaft?
Die Haltung gegenüber Migration wird in Richtung Abwehr geändert. Das kommt sicherlich bei vielen an und wird an der einen oder anderen Stelle auch Geld sparen, es wird aber die Realität globaler Migrationsströme nicht ändern. Deshalb bleibt die Aufgabe bestehen, die Integrationsprozeduren vor allem den Zugang zur Arbeit effektiver zu gestalten.
Was fehlt?
Die richtige Verteilungsfrage. Zum einen wird nur die emotional aufgewühlte Verteilungsdebatte zwischen Bürgergeldempfängern und Niedriglöhnern adressiert. Hier ist es zwar richtig die Übergänge in Arbeit für Arbeitende günstiger zu gestalten. Die pauschale Faulheitsvermutung bei Bürgergeldempfängern, aus der sich der Wunsch nach stärkeren Sanktionen speist, ist jedoch unangemessen. Deshalb ist es umso ärgerlicher, wenn wirklich relevante Verteilungsfragen besonders mit Blick auf die erschreckend ungleiche Vermögensverteilung überhaupt aufgegriffen. In diesen Fällen geht es zudem um Beträge von wesentlich höheren Dimensionen als beim Bürgergeld. Der Verzicht auf eine steuerliche Verteilungspolitik dürfte der inhaltliche Preis für die Wahlniederlage der SPD sein. Dies dient nicht der Stabilität unserer Gesellschaft.
Gesamturteil: Machen.

Wenn es ein passendes Gesamturteil gibt, dann ist es wohl „Pragmatisch in bewegten Zeiten.“ Das ist Lob und Tadel zugleich. Es ist Lob, weil mit dem Investitionspaket und der Auslagerung von Verteidigungsausgaben Instrumente geschaffen wurden, mit denen man den maßgeblichen akuten Herausforderungen einer maroden Infrastruktur und den geopolitischen Bedrohungen begegnen läßt. Es ist aber auch Tadel, weil es im Vertrag auch vor kleinteiligen Maßnahmen zwecks Klientelbefriedigung nur so wimmelt. Auffällig sind vor allem tot geglaubte CSU Ladenhüter, wie die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie. Zum Glück steht dies und alle weiteren Steuergeschenke pragmatisch unter Finanzierungsvorbehalt.
Insgesamt sehe ich einen Koalitionsvertrag mit positiven Highlights, viel Kleinteiligkeit und einigen Schwachstellen.
Also, fangen wir an.